
SOLINGEN (mh) – Wer sich auf eine außergewöhnliche Zeitreise begeben möchte, der muss nicht weit reisen – im Nordwesten Deutschlands schlängelt sich eine ganz besondere Ferienstraße durch das sanfte Hügelland des Emslandes und die Wälder Niedersachsens: Die Straße der Megalithkultur. Auf rund 330 Kilometern verbindet sie 33 archäologische Stationen – gesäumt von mehr als 70 Großsteingräbern, die vor über 5000 Jahren entstanden.
Diese monumentalen Grabanlagen stammen aus der Jungsteinzeit (ca. 3500–2800 v. Chr.) und geben faszinierende Einblicke in das Denken, Fühlen und Glauben der frühen Ackerbauern. Ihre Spiritualität, ihr Verständnis von Natur und das alltägliche Leben spiegeln sich in jedem Stein, jeder Kammer wider. Einige der Stationen führen sogar zu Grabhügeln aus der Bronze- und Eisenzeit – ein faszinierender Blick auf mehr als drei Jahrtausende Menschheitsgeschichte.
Megalithkultur: Uralte Riesen und stille Zeugen der Vergangenheit
Der Gedanke, all diese steinernen Zeitzeugen durch eine touristische Route zu verknüpfen, entstand im Jahr 2006. Seither hat sich die Straße der Megalithkultur zu einem Magneten für Kulturinteressierte, Wanderer und Familien entwickelt. Wir haben einige der eindrucksvollsten Stationen dieser Straße besucht – und sind begeistert zurückgekehrt.
Versteckt im dichten Grün des südlichen Emslandes liegt das Großsteingrab im Alt-Frerener Forst. Eine 20,5 Meter lange Kammer, von mächtigen Tragsteinen gestützt – nur vier der elf Decksteine sind vollständig erhalten. Doch die Aura des Ortes ist ungebrochen: still, fast ehrfürchtig ruht das Grab unter den hohen Bäumen.

Tiefer im Wald bei Thuine trifft man auf einen echten Riesen: das Großsteingrab Kunkenvenne. 25,5 Meter lang, mit 17 Jochen – ein beeindruckender Anblick! Das Ganggrab ist bemerkenswert gut erhalten. Besonders außergewöhnlich: zwei Steinkränze umgeben die Kammer, ein Detail, das sonst eher in Mecklenburg oder Jütland zu finden ist. Die Grabbeigaben – Werkzeuge, Bernstein, Gefäße – ruhen heute im Landesmuseum Hannover.
Zwischen Thuine und Langen öffnet sich eine kleine Lichtung – und inmitten der Kiefern liegt das Großsteingrab Radberg. Zehn gewaltige Decksteine sind noch sichtbar, die Umfassung nur noch fragmentarisch. Der Ort wirkt beinahe verwunschen – ein stiller Zeuge einer längst vergangenen Welt.
Ein Königreich aus Stein: De Hoogen Steener
Zwei besonders beeindruckende Grabkammern verstecken sich im Waldgebiet Klöbertannen bei Lingen: das kunstvoll erhaltene Steenhus und das benachbarte Ganggrab mit seiner leicht gewölbten Form. Besonders kurios: Tragsteine, die offenbar zu kurz gerieten, wurden mit Findlingen „unterfüttert“ – ein prähistorischer Trick, den man an mehreren Stellen der Ferienstraße entdecken kann.
Das längste Megalithgrab des Emslandes liegt nördlich von Werlte: De Hoogen Steener. 29 Meter misst die Kammer, 14 Decksteine sind erhalten. Bei Ausgrabungen fanden Archäologen hier 150 Keramikscherben und zahlreiche Werkzeuge. Der Name ist Programm – man fühlt sich tatsächlich klein neben diesen gewaltigen Steinmonumenten.

Ein echtes Highlight ist das rekonstruierte Grab von Ostenwalde, das 1971 aufgrund einer Straßenverbreiterung versetzt wurde. Statt die Decksteine wieder aufzulegen, ließ man sie seitlich liegen – so erlaubt die Anlage heute einen freien Blick in das Innere der Grabkammer. Eine kluge Entscheidung, denn sie macht das steinzeitliche Totenhaus für Besucher besonders greifbar.
Nirgends ist die Dichte an Großsteingräbern so hoch wie im Hümmling. Zwischen Hüven, Groß-Berßen und Sögel reiht sich Grab an Grab: das Königsgrab, das Wappengrab, die stillen Stätten bei Deymanns Mühle, die imposanten Volbers Hünensteine und viele mehr. Ein eigens angelegter Parkplatz mit Informationstafeln lädt zur Wanderung ein – wer sich Zeit nimmt, kann hier Tage voller Entdeckungen verbringen.
Steinerne Legenden: Die Teufelssteine von Vrees
Kurz vor Bischofsbrück ragen die mächtigen Teufelssteine aus dem Boden – eine vollständig erhaltene Kammer, drei Decksteine, einer davon gigantische 3 x 3 Meter groß. Der Name stammt aus Zeiten, als sich die Menschen nicht erklären konnten, wie solche Steinblöcke ohne Maschinen bewegt wurden. Also musste der Teufel Pate stehen.
Die Straße der Megalithkultur ist mehr als ein touristisches Projekt. Sie ist eine Einladung, in die tiefsten Wurzeln unserer Geschichte einzutauchen. Wer sich aufmacht, diesen archäologischen Schatz zu entdecken, der wird reich belohnt – mit faszinierenden Geschichten, eindrucksvoller Landschaft und einem neuen Blick auf die Menschen, die vor über 5000 Jahren lebten, glaubten, bauten und ihre Toten ehrten.

Wer sich von den Megalithgräbern ein Stück weiter westlich begibt, entdeckt ein ganz anderes, ebenso faszinierendes Kapitel der Natur- und Kulturgeschichte Nordwestdeutschlands: das Molberger Moor, regional auch als Molberger Dose bekannt. Dieses rund 600 Hektar große Hochmoor ist ein sogenanntes Kesselmoor, entstanden in einer eiszeitlichen Senke.
Weit und offen dehnt sich das Gelände aus, von Gräsern und Moosen durchzogen. Im Sommer leuchtet das Wollgras wie ein weißer Schleier über der Landschaft, während sich im Spätsommer violette Heideflächen ausbreiten – ein Farbenmeer, das verzaubert. Im Herbst liegt über dem Moor oft ein mystischer Nebel, der die stille Weite noch eindrucksvoller macht.
Ein Hauch von Wildnis: Das Molberger Moor
Ein Moorlehrpfad im Osten des Gebiets lädt Besucher ein, diesen einzigartigen Lebensraum aus nächster Nähe zu erkunden – ohne ihn zu stören. Auf befestigten Wegen und Bohlenstegen wandert man durch eine Welt, die ursprünglich, wild und gleichzeitig voller Leben ist. Infotafeln und Schaubilder erklären die Besonderheiten des Hochmoors, seine Geschichte, Gefährdung und die Maßnahmen zur Renaturierung.
Denn wie viele Moore in Nordwestdeutschland wurde auch die Molberger Dose früher entwässert und teilweise tiefgepflügt, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen. Heute verfolgt man das Ziel, durch Wiedervernässung den ursprünglichen Wasserhaushalt und damit auch die typische Vegetation zurückzubringen. Torfmoose, Sonnentau, Moorlilien und andere hochmoortypische Pflanzen kehren langsam zurück. Gleichzeitig profitieren seltene Vogelarten wie der Große Brachvogel, die Bekassine, der Raubwürger oder das Schwarzkehlchen vom neuen, alten Lebensraum.

Das Molberger Moor ist kein Ort, den man im Vorübergehen mitnimmt – es ist ein Ziel für sich. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt hier eine Welt voller Wunder: eine stille, schwebende Landschaft, in der Vergangenheit und Zukunft der Natur gleichsam nebeneinander existieren.
Ein Abstecher lohnt sich – für Naturfreunde und alle, die dem hektischen Alltag für einen Moment entfliehen möchten.
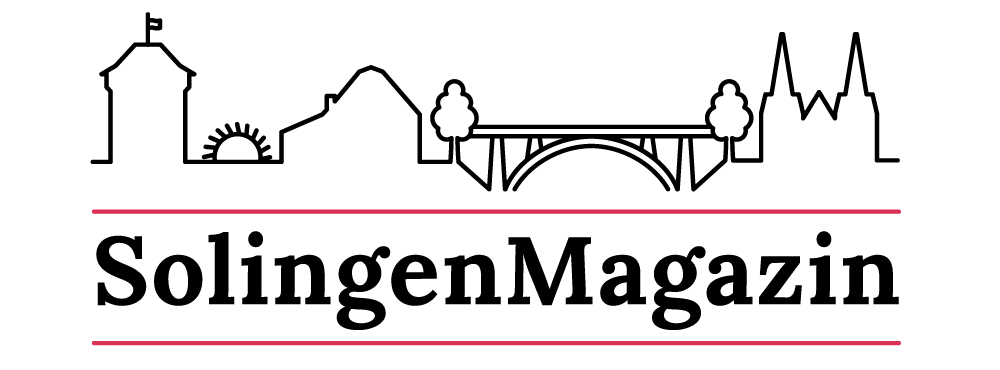
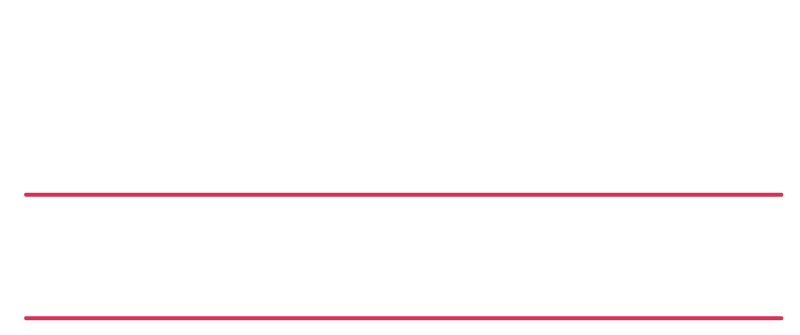



















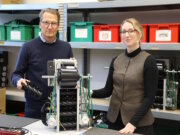


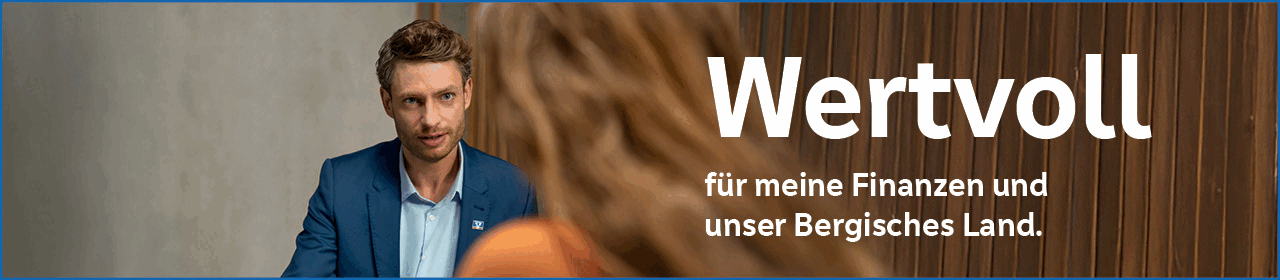



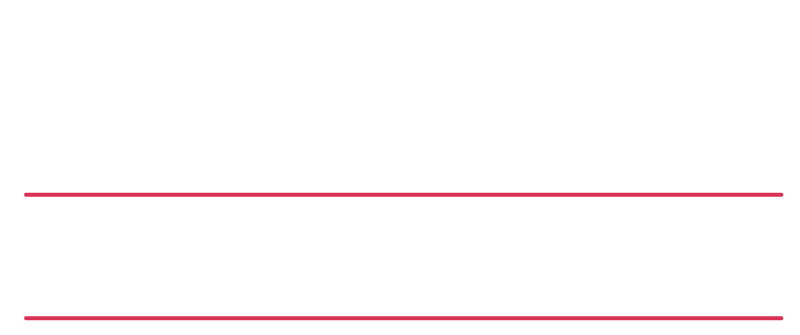




Dies ist eine wirklich ganz wundervolle Beschreibung tief berührender und faszinierender Orte, die Geschichte atmen lassen.
Dorthin zu reisen ist, wie das Eintauchen in eine Welt.
Zeit bekommt eine andere Bedeutung.