
Von Svitlana Glumm
Engelsklinge
Buch 2 – In Nebel gehüllt
Aus dem Russischen
Kapitel 1.2
Das Mädchen sah die Schüler an – durchdringend, kühl, aber nicht feindselig.
Im Flur waren nur noch Kinder unter zwölf Jahren geblieben. Die Jugendlichen waren sofort gegangen, sobald die Antwort ertönte, und machten dabei weiterhin bissige Scherze übereinander. Sie bemerkte, dass die Ältesten unter ihnen kaum siebzehn waren, und es waren nur wenige. Lucia wusste, dass Kinder bis achtzehn Jahre ins Lager aufgenommen wurden. Danach galt man als alt genug, um für sich selbst zu sorgen – und um bei der Leitung zu helfen, die sie alle gerettet hatte.
Anfang des Jahres 2095 gab es in jedem Land mindestens zwei Verwaltungsstellen. Selbst hier, in Nordamerika, befanden sich „Saviour“-Verwaltungen in New York, Chicago, Seattle und Austin.
„Saviour“, Lucia schnaubte – was für seltsame Wesen die Menschen doch sind: immer müssen sie ihren Institutionen bombastische Namen geben, um eine Spur für die Nachwelt zu hinterlassen.
Ich habe keine Ahnung, was ich euch antworten soll, Kinder, schoss es Lucia durch den Kopf. Sie öffnete den Mund, bereit, das Erste herauszuplatzen, was ihr einfiel – was nichts anderes war als ein Spruch, den sie vom Psychologen kannte –, da ertönte erneut die Schulglocke. Lucia zwang sich zu einem freundlichen Lächeln für das Mädchen, das enttäuscht mit den Wimpern klimperte.
Der Glockenton ließ die Kinder in die Klassenzimmer verschwinden. Auf dem Flur erschienen Jugendliche. Einer kaute im Gehen noch an einem Sandwich, zwei Jungs diskutierten ein Chemie-Experiment, das sie in der ersten Stunde durchgeführt hatten. Am Ende der Gruppe ging ein Mädchen mit zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenem, kastanienbraunem Haar. Lucia biss sich auf die Unterlippe.
Das Schulmädchen hätte durchaus hübsch sein können, wenn nicht blassrosafarbene Narben ihr Gesicht von der Stirn bis zum Kinn durchzogen hätten. Deshalb konnten selbst das niedliche Näschen und die langen Wimpern das entstellte Erscheinungsbild, das leicht zum Ziel von Spott unter Klassenkameraden hätte werden können, nicht mildern.
Doch Lucias erster Eindruck trog: Statt Abscheu zu empfinden, fühlte sie sich auf unerklärliche Weise zu dem Mädchen hingezogen. Ihre Gedanken lesend, hob sie sie sofort aus der Masse der Kinder heraus.
Lucia sah Bilder aus Erinnerungen an eine glückliche Kindheit – mit den Eltern in Calgary, Ausflüge zur Großmutter nach Montreal, Spiele mit Freunden im Garten hinter dem Haus. Diese Erinnerungen linderten das Gefühl der Einsamkeit, das sie überkam, wenn das Lager in nächtliche Stille versank und sie mit ihren Ängsten allein war.
Zwischen diesen hellen, sorglosen Gedanken an ihr Elternhaus tauchte oft eine andere, schmerzhaft pulsierende Erinnerung auf – die an eine Tragödie.
Plötzlich erschien ein Bild des Autoinnenraums: ein fröhliches Lied lief, die Mutter plapperte über die Freisprechanlage mit einer Freundin, der Vater versprach, dass sie bei einer Klassenkameradin vorbeifahren würden, die den Sommer bei einer Tante in der Nähe von Montreal verbrachte.
Dann verschwammen die Bilder, lösten sich auf wie feiner Nebel, der sich in die Tiefen des Unterbewusstseins zurückzog. Zurück blieb ein Gefühl der Verwirrung. Es schnürte ihr die Kehle zu, ließ keinen Raum für hemmungslose, bittere Tränen oder lautes Schreien.
Ein Drittklässler hustete, um Aufmerksamkeit zu erregen. Lucia hob fragend die Augenbrauen. Bis auf das Mädchen mit dem gelben Band im Haar stand niemand mehr bei der Treppe.
„Also, sagen Sie es uns – wer sind Sie?“ Das Mädchen ließ nicht locker.
„Später. Nach dem Unterricht. Ich habe es eilig.“
Die Jugendlichen betraten das Klassenzimmer und Lucia hörte auf, die Gedanken des Mädchens mit den Narben zu lesen. Das etwa achtjährige Mädchen rückte ihr Band zurecht und seufzte ergeben. „Na gut“, stimmte sie zu. „Ich muss zum Unterricht“, sagte sie und drohte Lucia mit dem Zeigefinger. „Aber Sie dürfen das Lager nicht verlassen – ich finde Sie sowieso und dann müssen Sie antworten!“
Lucia schmunzelte. Zeit zu verschwinden, bevor das Gör noch auf die Idee kam, Detektivin zu spielen und das Gebäude nach der Fremden abzusuchen.
Sie nickte ernst und begann, die Treppe zum dritten Stock hinaufzusteigen.
„Ich heiße Gretta“, ertönte die helle Stimme hinter ihr.
„Aha“, antwortete Lucia gleichgültig, ohne sich umzudrehen. „Werd’s mir merken, Gretta.“
„Und wie heißt du?“ fragte das Mädchen frech, ohne um Erlaubnis zu bitten, zum Du überzugehen.
Lucia schnaubte ärgerlich. Ganz schön anhänglich, die Kleine. Vom Flur klackerten Absätze. „Gretta Lingred, ab in den Unterricht!“, rief eine Frauenstimme. „Deine Hefte warten schon auf deinem Tisch.“
Lucia hörte noch Grettas unzufriedenes Schnauben, als diese gezwungen war, ihr vorheriges „Spiel“ – die Fremde im Flur zu belästigen – aufzugeben. Widerwillig trottete sie dem Lehrer in den Klassenraum hinterher. Lucias Mundwinkel hoben sich leicht. Schule geht vor, Gretta, dachte sie, nicht ohne Genugtuung darüber, dass die Mathelehrerin ihr das Anhängsel abgenommen hatte.
Nachdem sie die Aula durchquert hatte, stand Lucia vor dem Büro des Psychologen. Die Stille, die nach dem letzten Gong in den Gängen herrschte, ließ sie das gleichmäßige Atmen hinter der Tür deutlich vernehmen. Sie zog an der Klinke.
Der Raum des Psychologen war klein – eher winzig. Ein großes Fenster auf der Südseite spendete Licht. Außer einem Schreibtisch, der mit Stiften, Akten und einem Haufen Unterlagen überhäuft war, sowie einigen Sesseln, befand sich in der rechten Ecke eine Liege. Wahrscheinlich für lange Gespräche mit Patienten, schoss es Lucia durch den Kopf. Das monotone Ticken des Pyramiden-Metronoms auf dem Tisch wirkte beruhigend.
Die Person im Raum hatte offenbar keinen Besuch erwartet und es nicht geschafft, rechtzeitig die Füße vom Tisch zu nehmen. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen und geschlossenen Augen lümmelte ein Jugendlicher im Sessel des Psychologen. Als er Lucia bemerkte, nahm er zögernd die Füße vom Tisch und setzte sich aufrechter hin. In seinem schmalen Gesicht erschien ein kaum sichtbares Lächeln und in seinen grünen Augen spiegelte sich Überraschung, die er unter einer Maske aus Gleichgültigkeit zu verbergen versuchte.
„Elijah ist nicht da“, sagte der Jugendliche, schüttelte den Kopf, woraufhin seine dichte, lockige Haarmähne auflebte. Zwei Strähnen fielen ihm in die Stirn und verdeckten die Augen. Mit der Hand strich er sie sofort wieder zurück, um die widerspenstigen Haare zu bändigen.
„Hab ich schon bemerkt“, entgegnete Lucia mit einem leichten Grinsen. „Ich warte, wenn’s dir nichts ausmacht.“
Der Jugendliche zuckte mit den Schultern und lehnte sich wieder zurück.
„Wie du willst“, sagte er gleichgültig und starrte dann die weiße Decke an. Auch er sprach mit Akzent, aber nicht so fürchterlich wie Dennis.
Lucia öffnete ihre Lederjacke und ließ sich in einem Sessel gegenüber vom Tisch nieder. Wo steckt Elijah bloß?, dachte sie. Ich will nur meinen Auftrag abholen und so schnell wie möglich aus diesem Kindergarten verschwinden.
Mangels besserer Beschäftigung widmete sie sich einem ihrer liebsten Hobbys – dem Gedankenlesen. Der Junge am Tisch war vermutlich etwa sechzehn Jahre alt. Und natürlich – woran sollten Teenager sonst denken, wenn nicht an all die Dinge, die ihnen in diesem Alter am wichtigsten erscheinen: an den letzten Fußballsieg, daran, sich mit Freunden zu messen oder vor allen mit seiner Freundin zu prahlen.
Lucia war schon bereit, zu erfahren, ob ihn nicht auch die klassischen Teenagerfragen quälten – Dreht sich das Universum nur um mich? Wie zähme ich das Chaos meiner Gefühle? Wird die Welt mich akzeptieren – jetzt, wo ich ein Teil dieser verwirrenden Erwachsenenwelt mit Rechten und Pflichten bin?
Doch dann traf sie eine ganz andere Gedankenwelle – negative Gedanken. Schlechte Gedanken. Lucia verzog das Gesicht, fing sich jedoch schnell wieder und schenkte dem Jungen ein Lächeln, um nicht den Verdacht zu erwecken, dass sie seine Geheimnisse kannte. Natürlich wusste Elijah davon – schließlich hatte er den Jungen zu sich bestellt.
Er war seit letzten September im Lager, und die Therapie war noch lange nicht abgeschlossen. Kein leichter Job, so ein Heiler, dachte Lucia. Was für unterschiedliche Patienten einem da unterkommen. Sie hörte auf, seine Gedanken zu lesen, doch der Nachgeschmack dessen, was sie gesehen hatte, legte sich schwer auf ihre bis dahin gute Stimmung.
In ihrem Kopf hallten noch die Ermahnungen eines Mannes wider, der sie für irgendeinen Streich zurechtgewiesen hatte. Vor ihren Augen flackerte das Emblem auf einem blauen Blazer: ein hellblauer Kreis mit gelben Flügeln und gekreuzten Schwertern. In der Mitte war ein gekrönter Löwe eingraviert.
Das Bild verschwamm – es löste sich auf in weiße Linien. Viele weiße Linien aus Pulver. Namen von Drogen stiegen aus den Tiefen des Unterbewusstseins auf.
Der Junge hatte versucht, seinen Schmerz zu betäuben – einen Schmerz, der ihn Tag und Nacht verfolgte. Gespräche mit Freunden im strömenden Regen, in denen er gemeinsame Spiele am Computer ablehnte, nur um rechtzeitig die nächste Dosis zu besorgen…
Die Erinnerung des Jungen an den letzten Abend seines früheren Lebens brachte Lucia zurück zu dem Gedanken an die Grausamkeit der Menschen. Blut, das Knacken von Knochen, das grobe Gebrüll fremder Stimmen. Schreie, die sich ineinander vermischten und schließlich zu einem einzigen wurden – zu seinem eigenen. Und Hass. Hass auf jene, die ihm das angetan hatten. Wut auf sich selbst. Hilflosigkeit. Und dann wieder Wut – diesmal auf die Welt, die tatenlos zugesehen hatte, wie die Tragödie geschah.
Auf Hass und Wut folgte Apathie.
Sie kroch aus den dunklen Winkeln seines Bewusstseins und erfüllte seine Seele.
Apathie – ein heimtückischer, lautloser Mörder der Menschheit.
Da öffnete sich die Tür und Elijah erschien auf der Schwelle.
Lucia drehte sich um und musterte abschätzend den Engel, der für unbestimmte Zeit das Recht hatte, ihr Befehle zu erteilen. Der graue Anzug saß makellos an dem großen, stattlichen Mann mit den ausdrucksstarken dunkelbraunen Augen.
Lucia erhob sich aus dem Sessel.
Mit der Leichtigkeit, wie sie nur Engel besitzen, trat Elijah auf sie zu und schenkte ihr ein respektvolles Lächeln.
„Elijah Conn“, sagte er und reichte ihr die Hand.
Lucia bemerkte, dass die Hand des Heilers gepflegt war, ohne auch nur eine Kratzer. Ganz im Gegensatz zu ihren – oft mit Schwielen von den Trainingsstunden und abgebrochenen Nägeln übersät.
Zum Glück hatte sie die letzten zwei Wochen nach dem Umzug in die USA mit der Suche nach einem Transportmittel, Hausrat und vor allem mit Schlafen in ihrem eigenen Bett verbracht. Letzteres hatte sie besonders genossen, und sie hatte Leo nicht erlaubt, sie zu stören.
Nicht einmal an Silvester hatte sie eine Ausnahme gemacht.
Lucia hatte geahnt, dass sie im Lager neben ihrer eigentlichen Arbeit auch viele Tränen von Teenagern würde trocknen müssen – also hatte sie beschlossen, die letzten Tage ihrer Freiheit voll auszukosten.
„Lucia Neri“, erwiderte sie und schüttelte die Hand des Psychologen.
„Habt ihr euch schon bekannt gemacht?“, fragte Elijah und wandte sich an den Jugendlichen.
Kaum war Elijah zum Tisch getreten, wurde der bis dahin regungslos dasitzende Junge plötzlich lebendig, als hätte ihn allein die Anwesenheit Lucias belastet.
Ein freundliches Lächeln trat auf seine Lippen, er sprang auf und reichte Elijah die Hand.
„Nein“, sagte der Junge, während er Lucia über die Schulter hinweg ansah – mit der gleichen Gleichgültigkeit, die man einem leeren Stuhl entgegenbringen würde.
Lucia schnaubte verächtlich.
Deine Gleichgültigkeit ist nur eine Seifenblase, Kumpel.
Du bist wie eine kaputte Puppe, die krampfhaft versucht zu zeigen, dass sie nicht zum Sperrmüll gehört.
„Ian Graham“, stellte Elijah den Jugendlichen schließlich vor.
Sei gnädig, Lucia, hörte sie Elijahs Gedanken.
Ian ist misstrauisch gegenüber Fremden – du solltest das doch am besten wissen.
In seinen dunkelbraunen Augen glomm etwas auf, das einer stillen Bitte glich.
Lucia biss die Zähne zusammen, um den Anflug von Gereiztheit niederzukämpfen, der in ihr aufstieg, als Elijah erneut eine mentale Mauer errichtet hatte, die sie daran hinderte, durch die dichten Zypressenstämme seiner Gedanken zu dringen.
Sie schüttelte leicht den Kopf, um sich Zeit zu geben, Elijahs Worte einzugestehen – dem Mann, der seit Monaten versuchte, das Böse aus Ians Seele zu vertreiben.
Dann trat sie auf den Jugendlichen zu, zauberte ein freundliches Lächeln auf ihr Gesicht und streckte ihm die Hand entgegen.
Offenbar war ihr Lächeln gelungen – denn Ian nahm die Hand an und schüttelte sie.
„Lucia wird in meinem Team arbeiten“, verkündete Elijah und ließ Ian dabei nicht aus den Augen. „Wie auch Leo.“
Die Nachricht, dass die Fremde zum Psychologenteam gehören sollte, verwirrte Ian sichtlich. In seinen grünen Augen flackerte Misstrauen auf.
„Leo?“ fragte er nach.
„Er war heute Morgen da – du warst im Unterricht“, erklärte Elijah, wobei er Lucia einen kurzen Blick zuwarf. „Leo ist bereits im Einsatz“, sagte er zu ihr, seufzte dann und legte Ian die Hand auf die Schulter. „Verzeih mir, mein Freund, dass ich dich von den geometrischen Figuren weghole“, ein Schmunzeln entrang sich Elijahs Brust. „Aber du musst leider zurück in den Unterricht und dich mit der heimtückischen Hypotenuse auseinandersetzen. Ich muss unserer neuen Mitarbeiterin den Direktor vorstellen. Wir sprechen nach der letzten Stunde, einverstanden?“ Elijah klopfte dem Jungen freundschaftlich auf die Schulter.
Der Heiler sprach mit seinem Patienten nicht wie mit einem problematischen Teenager – das hatte Lucia bereits gemerkt, noch bevor sie seine Gedanken gelesen hatte – sondern wie mit einem alten, vertrauten Freund. Und Ian antwortete Elijah auf dieselbe Weise.
Wie macht ihr das nur, ihr Heiler? fragte sich Lucia einmal mehr. Wie schafft ihr es, nicht nur ausgezeichnete Spezialisten zu sein, sondern auch das Vertrauen derjenigen zu gewinnen, die Hilfe brauchen?
Die besondere Gabe der Heiler war ihr Mitgefühl.
Sie versetzten sich immer in die Lage ihrer Klienten – egal, was diese getan hatten –, halfen ihnen, ihre Probleme aus einem neuen, positiven Blickwinkel zu betrachten, und ließen sie nicht allein, bis sie sich vollständig erholt hatten.
Sie riefen an, besuchten sie zu Hause, sprachen mit Angehörigen – einfach, um in schweren Zeiten zu unterstützen.
Vielleicht liegt genau darin der Grund, warum die Menschen euch vertrauen, schoss es Lucia durch den Kopf.
Ihr seid reine Güte.
Sie schüttelte sich innerlich.
Nein, das ist nichts für mich. Ich würde verrückt werden, wenn ich ständig die Staubkörner von den Seelchen dieser Leute pusten müsste.
Klar, heute Morgen hatte sie noch darüber nachgedacht, wie sie es schaffen könnte, sich den Respekt der Jugendlichen zu erarbeiten. Aber ein Freund sein ist das eine – ein Babysitter das andere. Und wenn du mir so etwas vorschlagen willst, Elijah, dann wird unser Gespräch sich nicht auf Nettigkeiten beschränken. Ich ziehe ernste Gespräche jedem rührseligen Seelenstriptease vor. Und dann sehen wir ja, auf wessen Seite die Wahrheit steht, wenn du es zu weit treibst.
Es schien, als habe Ian sich nicht darüber geärgert, dass seine gemeinsame Zeit mit dem Psychologen nun von der neuen Mitarbeiterin in Anspruch genommen wurde. Oder er ließ es sich zumindest nicht anmerken, dachte Lucia trocken, ohne große Lust, erneut in seinem Kopf herumzustochern.
Was ich schon erfahren habe, reicht mir völlig.
Der Jugendliche zuckte mit den Schultern, das Lächeln verschwand zwar, doch ein Ausdruck völliger Gleichgültigkeit kehrte nicht zurück in sein scharf geschnittenes Gesicht.
Langsam ging Ian um den Tisch herum und steuerte auf die Tür zu, dabei streifte er Lucia beim Vorbeigehen.
„Dann bis später“, sagte er – in derselben gleichgültigen Tonlage wie zuvor.
„Abgemacht“, antwortete Elijah mit einem Lächeln.
– Fortsetzung folgt –
Zur Autorin
Svitlana Glumm wurde in Kropywnyzkyj in der Ukraine geboren. Die 45-Jährige studierte an der dortigen Universität Geschichte und später an der Uni in Kiew Journalismus. Als Journalistin arbeitete sie über zehn Jahre für Zeitungen in Kiew und Kropywnyzkyj. Sie verfasste mehrere Bücher, Manuskripte und Kurzgeschichten rund um die Themen Fantasy und Mythologie. Seit April 2022 lebt sie in Solingen.
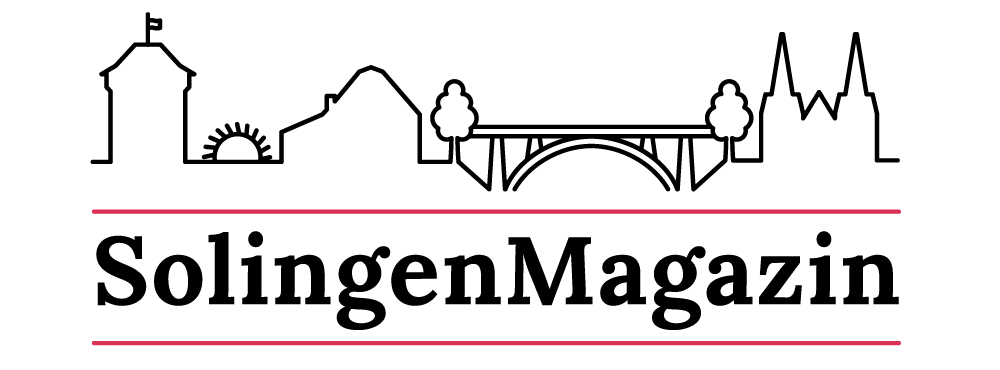
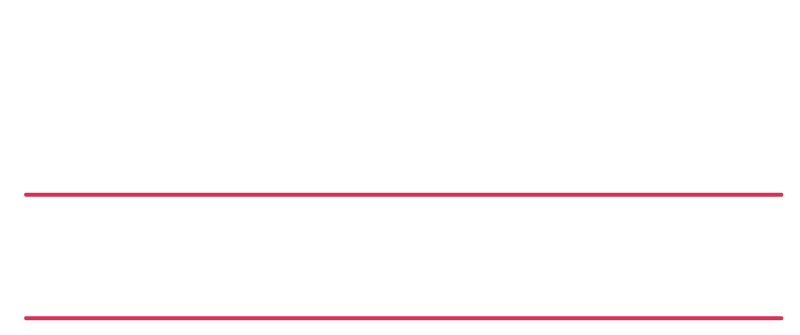
![PV-Modulreinigung: Wie CELSIUS [1.5] Verschmutzung fachgerecht entfernt Professionelle PV-Modulreinigung mit Reinwasser und Spezialbürste: So werden Ablagerungen schonend und rückstandsfrei entfernt. (Foto: © CELSIUS [1.5])](https://solingenmagazin.de/wp-content/uploads/celsius-pv-reinigung-photovoltaik-11-180x135.jpeg)
























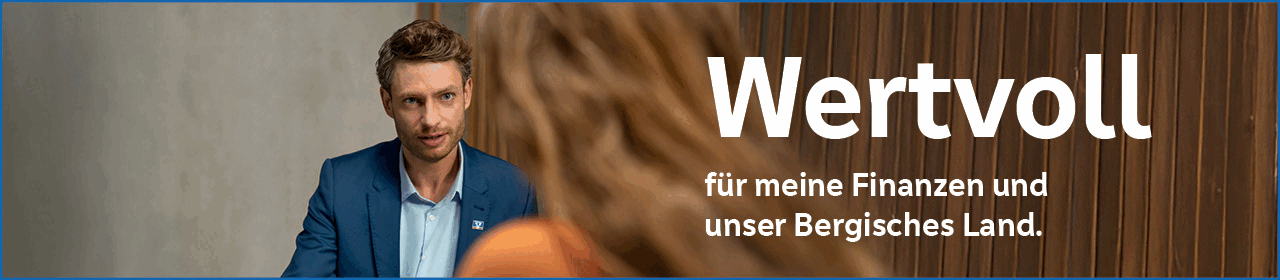
![PV-Modulreinigung: Wie CELSIUS [1.5] Verschmutzung fachgerecht entfernt Professionelle PV-Modulreinigung mit Reinwasser und Spezialbürste: So werden Ablagerungen schonend und rückstandsfrei entfernt. (Foto: © CELSIUS [1.5])](https://solingenmagazin.de/wp-content/uploads/celsius-pv-reinigung-photovoltaik-11-238x178.jpeg)


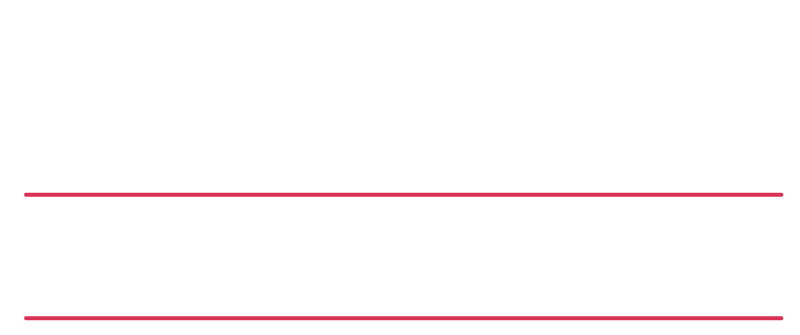
![PV-Modulreinigung: Wie CELSIUS [1.5] Verschmutzung fachgerecht entfernt Professionelle PV-Modulreinigung mit Reinwasser und Spezialbürste: So werden Ablagerungen schonend und rückstandsfrei entfernt. (Foto: © CELSIUS [1.5])](https://solingenmagazin.de/wp-content/uploads/celsius-pv-reinigung-photovoltaik-11-100x75.jpeg)


![PV-Modulreinigung: Wie CELSIUS [1.5] Verschmutzung fachgerecht entfernt Professionelle PV-Modulreinigung mit Reinwasser und Spezialbürste: So werden Ablagerungen schonend und rückstandsfrei entfernt. (Foto: © CELSIUS [1.5])](https://solingenmagazin.de/wp-content/uploads/celsius-pv-reinigung-photovoltaik-11-300x160.jpeg)